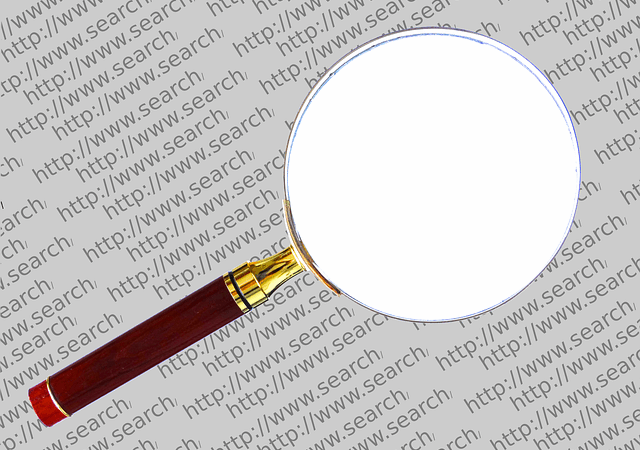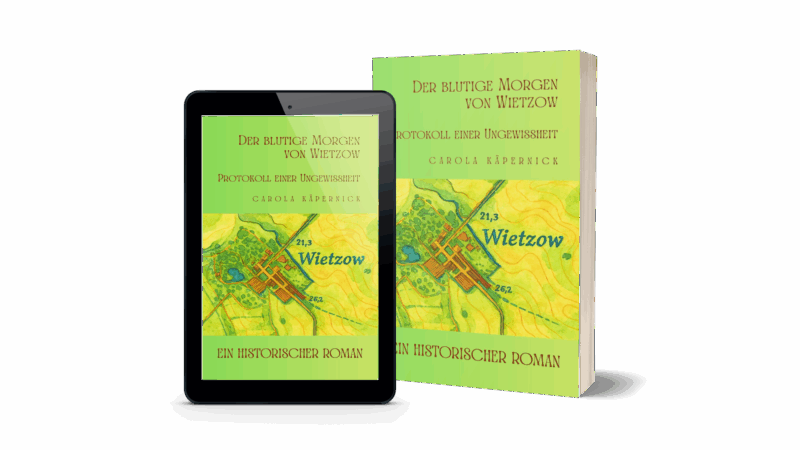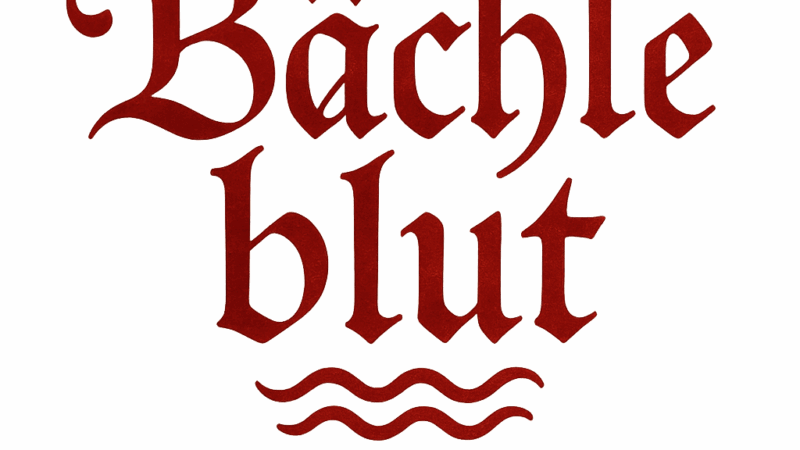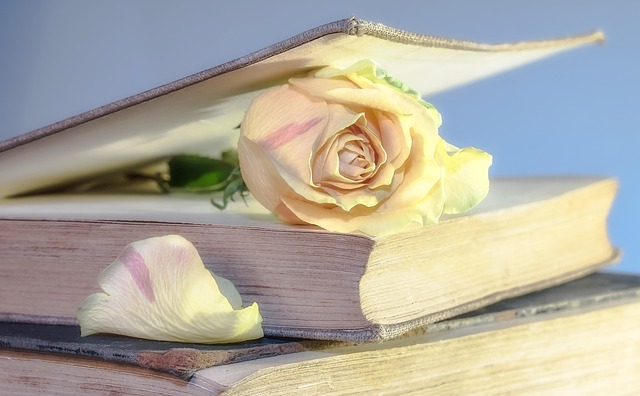Vom Archiv zum Buch: Schreiben über Wietzow
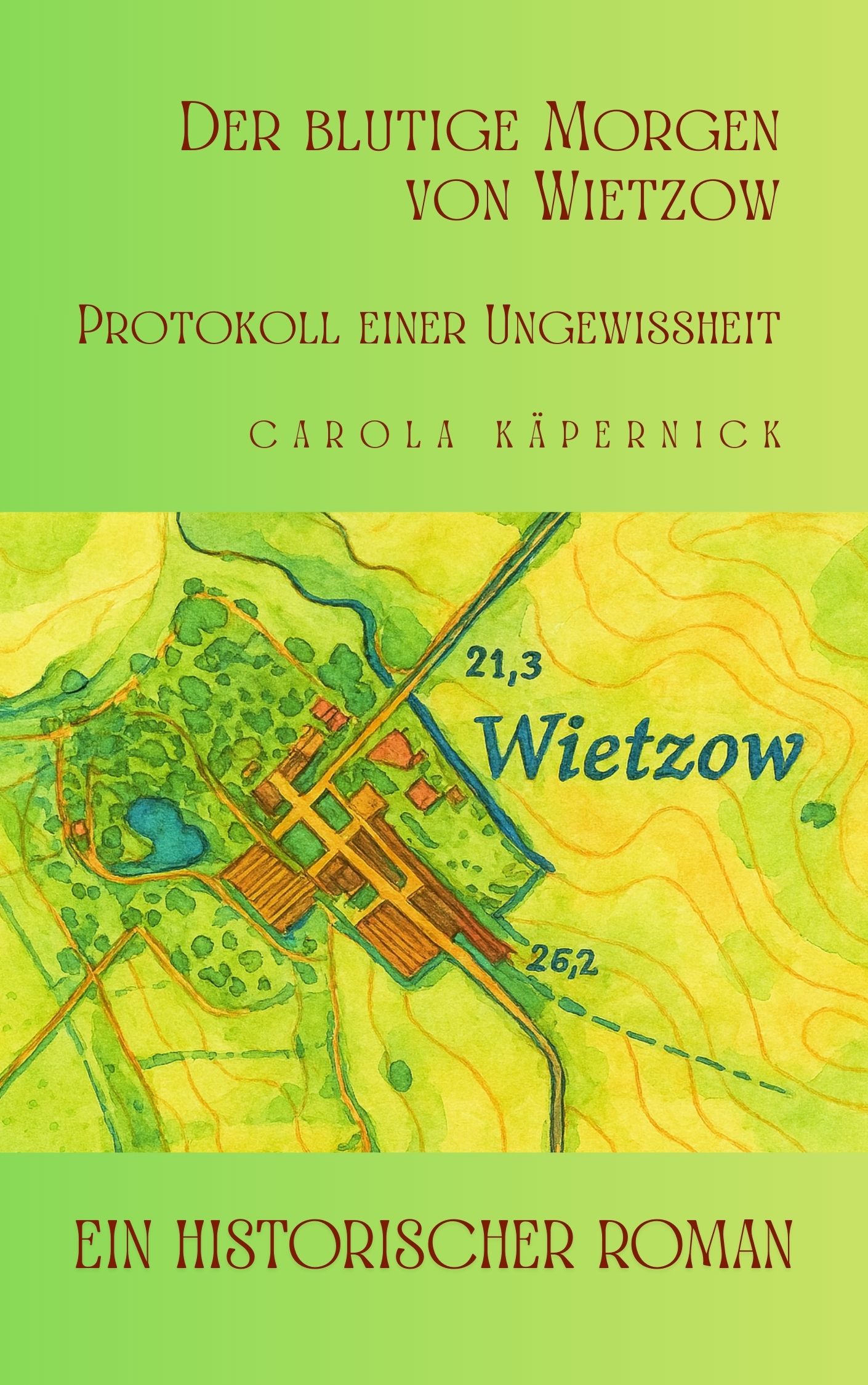
Warum ausgerechnet Wietzow? (Und warum ich nicht loslassen konnte)
Ich bin in Demmin geboren und in der Gegend aufgewachsen. Wer in einer Landschaft groß wird, in der Backstein, Wasser und Wind das Tempo bestimmen, trägt ihre Geschichten länger mit sich herum, als man denkt. Wietzow, Demmin, Broock – das sind Orte, die für Außenstehende vielleicht nur Punkte auf der Karte sind. Für mich bedeuten sie Gerüche, Stimmen, Wege. Diese Nähe war der erste Antrieb: Heimatgeschichte nicht als Postkarte, sondern als lebendiges Gewebe.
Recherche heute: leichter als je – aber nicht einfacher
Für das Buch habe ich intensiv recherchiert: Zeitungsjahrgänge, Karten, kirchliche Verzeichnisse, alte Bahnrouten, Jagdordnungen und natürlich die kleinen Alltagsdetails, an denen historische Romane oft scheitern (wie weit kommt eine Kutsche wirklich in zwei Stunden? Wie nennt man 1893 die Setzmaschine?).
Das Überraschende: Die Hürden liegen heute seltener in der Verfügbarkeit, öfter in der Auswahl. Vieles ist digital auffindbar – katalogisiert, gescannt, durchsuchbar. Doch je leichter der Zugriff, desto wichtiger wird die Frage: Was gehört tatsächlich ins Buch? Ich habe gelernt, Quellen streng zu gewichten: Was ist belegt? Was ist nur Anekdote? Was ist romantische Rückprojektion? Die Recherche wurde damit weniger Schatzsuche als Filterarbeit – mit der Bereitschaft, Lücken stehen zu lassen, statt sie mit hübschen Vermutungen zuzukitten. Und zum Glück kann ich alte Schrift lesen. Danke an Tante Trude, die es mir beigebracht hat.
Die Form: eine „Chronik der Ungewissheiten“
Früh war klar: Ich will keinen Roman, der am Ende jede Frage beantwortet. Der historische Stoff, um den es geht, schwankt zwischen Protokoll, Gerücht und Schweigen. Daraus entstand die Form, die das Buch trägt: eine „Chronik der Ungewissheiten“.
Sie funktioniert so:
- Belegte Funde stehen sauber und knapp.
- Offene Punkte werden benannt – als offene Punkte.
- Motive werden nicht frei erfunden, sondern nur dort berührt, wo Quellen einen Rand zeigen.
Mehr will ich hier nicht verraten, aber die Form lädt dazu ein, mitzudenken: Wer profitiert vom Schweigen? Was lässt sich tatsächlich beweisen – und was bleibt, trotz aller Mühen, im Halbdunkel? Die Neugier entsteht aus dem, was nicht glatt gebogen wird.
Nähe ohne Nostalgie
Der Heimatbezug verführt zur Nostalgie – ich habe bewusst dagegen angeschrieben. Statt „früher war alles anders“ interessiert mich: Wie klang ein Amt, ein Dorf, ein Gutshof, wenn der Alltag knirschte? Welche Wörter passten in eine Zeitung von 1893, ohne modern zu klingen? Wie fühlte sich eine Küche an, in der man aufräumte – und dabei vielleicht unbeabsichtigt Spuren verwischte? Solche Details machen historische Texte glaubwürdig, ohne den Leser*innen eine Vorlesung zu halten.
Quellen vs. Roman: meine Spielregeln
Damit das Buch stimmig bleibt, habe ich mir drei Regeln auferlegt:
- Belegte Sprache zuerst. Wo immer möglich, benutze ich zeitnahe Begriffe und vermeide Retro-Folklore.
- Kein falscher Trost. Lücken werden markiert, nicht kaschiert.
- Erzählen statt referieren. Recherche ist kein Selbstzweck – sie muss atmende Szenen ermöglichen.
Diese Spielregeln haben mir geholfen, die Fülle an Material in lesbare Szenen zu verwandeln, ohne die historische Redlichkeit zu verlieren.
Was die Recherche mir gezeigt hat
- Zugang: Archive, Bibliotheken und digitale Sammlungen sind heute erstaunlich offen – wer weiß, wonach er sucht, kommt weit.
- Tempo: Die größte Zeitersparnis liegt im Vergleichen – drei Quellen nebeneinanderlesen und Widersprüche ernst nehmen, statt die erstbeste zu nehmen.
- Demut: Je tiefer die Recherche, desto häufiger sagt man ehrlich: Wir wissen nicht alles. Genau dort beginnt Literatur.
Für wen ich dieses Buch geschrieben habe
Für Leser*innen, die historische Stoffe ohne Glorienschein mögen. Für Menschen, die eine Region kennen (oder kennenlernen wollen), ohne dass ihnen jede Ecke erklärt wird. Und für alle, die Spannung darin finden, wie sich Zeitungen, Küchen und Amtsstuben zu einem Bild fügen – nie ganz vollständig, aber spürbar.
Fazit
„Der blutige Morgen von Wietzow – Protokoll einer Ungewissheit“ ist mein Versuch, Heimat und Geschichte so zu erzählen, wie man sie in alten Blättern oft nur ahnt: fragmentarisch, widersprüchlich, nah. Der Schreibprozess war eine Wanderung zwischen Akten und Imagination – mit dem festen Vorsatz, nicht mehr zu behaupten, als die Quellen tragen.
Wenn du neugierig bist, wie sich eine Chronik der Ungewissheiten liest, wirst du in Wietzow fündig. Den Rest verrät das Buch – nicht der Blog.