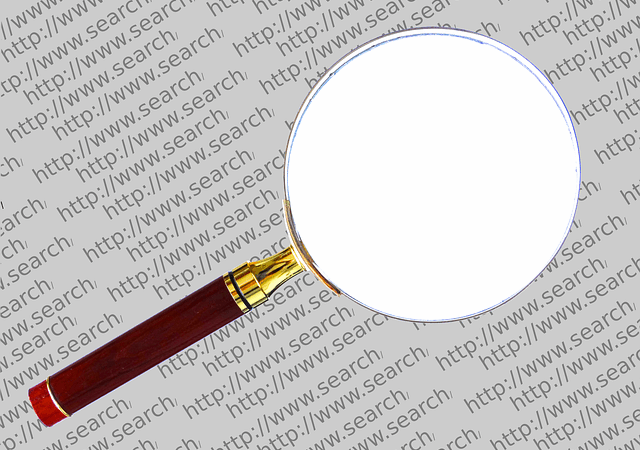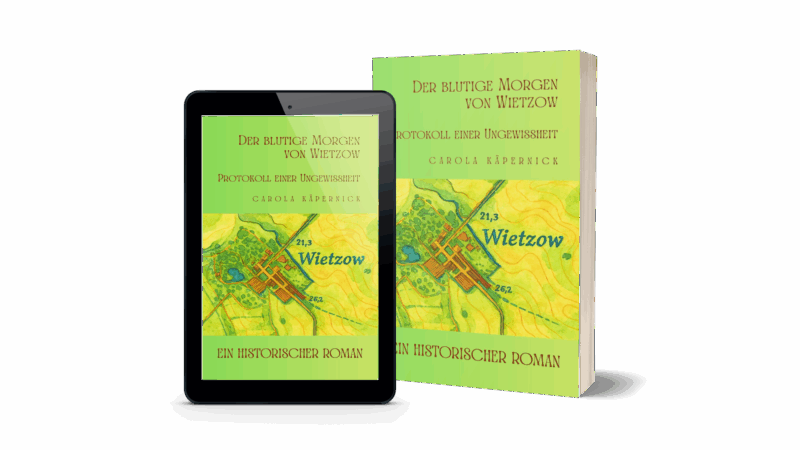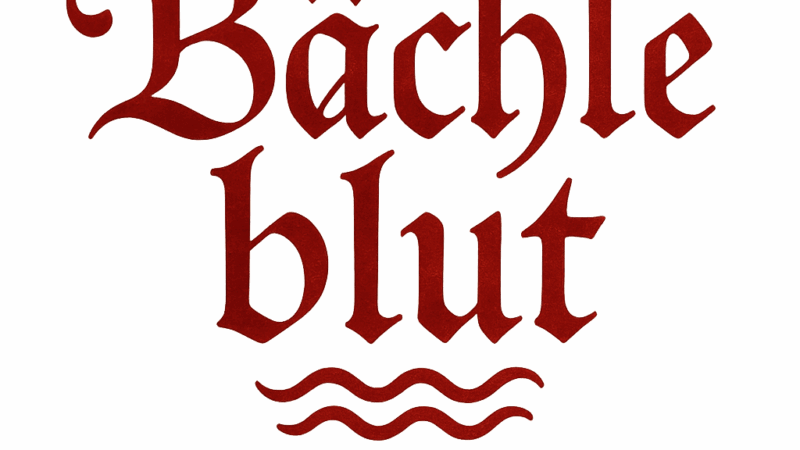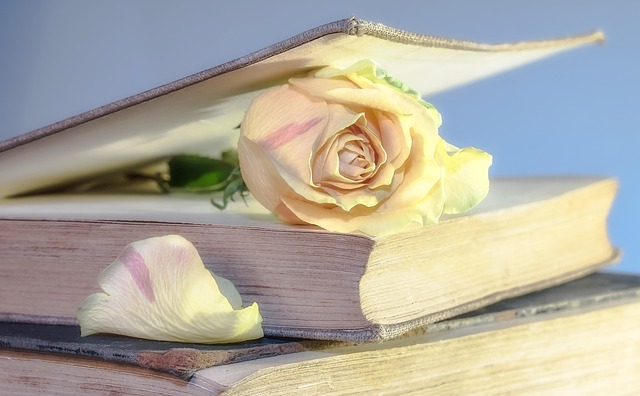Wie aus Recherche eine Romanbiografie wurde
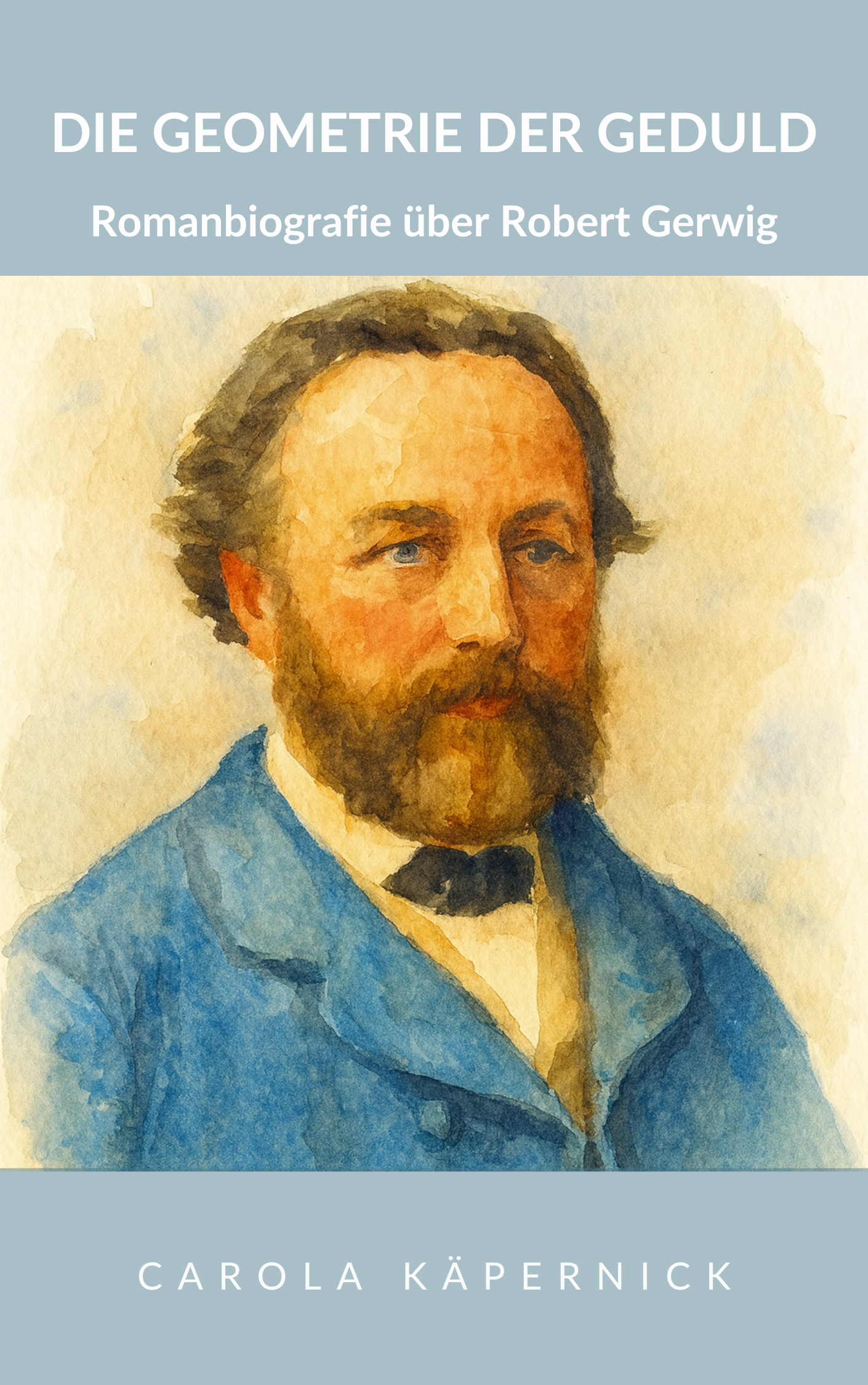
Schreibprozess zu „Die Geometrie der Geduld – Eine Romanbiografie über Robert Gerwig“
Manchmal genügt ein Satz, um ein ganzes Buch auszulösen. In meinem Fall war es die beiläufige Bemerkung meines langjährigen Lebensgefährten, der in Triberg geboren wurde: „Nach dem Gerwig ist die Schule benannt – war so ein Eisenbahningenieur.“ Mehr stand zunächst nicht im Raum. Kein großes Vorhaben, keine fertige Idee. Nur ein Name, eine vage Neugier – und ein Ort, der plötzlich eine andere Tiefe bekam.
Spurensuche ohne Nachlass
Schnell stellte sich heraus: Robert Gerwig war eine bedeutende Figur des technischen Fortschritts im 19. Jahrhundert. Und gleichzeitig ein Mann, über den sich nur schwer persönlich erzählen lässt. Denn: Es gibt kaum privaten Nachlass, keine Briefe, keine Tagebücher, keine Erinnerungen von Weggefährten. Die Biografie, die der Freiburger Architekt Hans Kunzenmüller 1952 veröffentlichte, ist solide – aber trocken. Sie beleuchtet den Ingenieur, nicht den Menschen.
Gerade das machte die Arbeit an diesem Buch so besonders herausfordernd – und reizvoll. Wer war dieser Mann, der nicht nur die Schwarzwaldbahn und den Gotthard mitprägte, sondern auch das Polytechnikum leitete, Museen aufbaute, die Uhrensammlung initiierte und im badischen Landtag saß? Wer war Robert Gerwig außerhalb seiner Tabellen, Zeichnungen und Ausschusssitzungen?
Lina: reale Figur, literarisch verdichtet
Lina war keine Erfindung. Sie war seine Frau, seine Briefpartnerin, seine Begleiterin über Jahrzehnte. Dass sie dennoch im öffentlichen Gedächtnis kaum vorkommt, war Anlass genug, ihr in diesem Buch Raum zu geben. Wo Quellen fehlten, wurde literarisch ergänzt – mit der nötigen Vorsicht. Lina wird nicht zur Erfindung, sondern zur Stimme des Privaten, des Dialogs, des Hinterfragens.
Ihre Figur erlaubt es, Gerwig nicht nur als Planer, sondern auch als Mensch zu zeigen. Sie eröffnet Perspektiven auf das, was zwischen den Baustellen geschah – in Karlsruhe, in Luzern, in Furtwangen. Und sie stellt Fragen: Wem nützt eine Entscheidung? Wer zahlt sie mit Zeit, mit Mühe, mit Rücksicht?
Form zwischen Dokument und Fiktion
Das Schreiben war ein ständiger Balanceakt: Wie viel darf man erfinden, ohne zu verfälschen? Wo endet das belegte Wissen, und wie lässt sich daraus dennoch ein glaubhafter Lebenslauf bauen? Die Antwort war eine neue Form: eine Romanbiografie, die sich an die dokumentierten Eckpunkte hält, dazwischen aber literarisch atmet.
Wo es sinnvoll erschien, wurden Zeitstimmen, fiktive Dokumente oder Lehrdialoge eingebaut. Nicht als Spielerei, sondern als Versuch, das Denken, Fühlen und Handeln einer Zeit in Sprache zu übersetzen. Dabei blieb der Ton stets sachlich, die Sprache sorgfältig, die Erfindung zurückhaltend.
Maß und Mensch
Das Buch ist kein klassischer Roman, aber auch keine rein sachliche Biografie. Es ist ein Versuch, Maß zu nehmen – an einem Menschen, an einer Haltung, an einer Epoche, in der Technik nicht nur Fortschritt bedeutete, sondern auch Verantwortung. Gerwigs Entscheidungen sind oft nüchtern, seine Sprache klar, seine Wirkung dauerhaft. Genau das macht ihn so erzählenswert.
Und vielleicht liegt darin auch der Kern: Wer über Robert Gerwig schreibt, schreibt nicht nur über Technik, sondern über Verlässlichkeit. Über das Maßhalten im großen wie im kleinen. Über das, was bleibt – auch wenn kein Denkmal es erzählt.